Zum Start der 9. Staffel von „Glücklich wohnen – der BUWOG-Podcast“ geht es um die emotionale Wirkung von Städten auf das Wohlbefinden. Zu Gast ist Prof. Dr. med. Mazda Adli, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, Leiter des Forschungsbereichs Affektive Störungen an der Charité und Chefarzt der Fliedner Klinik Berlin. Mit ihm spricht Moderator Michael Divé über das Forschungsfeld der Neurourbanistik, über das Citizen-Science-Projekt „Deine emotionale Stadt“ und darüber, wie Städte gestaltet werden können, dass sie die Gesundheit fördern und „Stadtstress“ reduzieren.
Das Forschungsgebiet Neurourbanistik möchte für Städte sorgen, die lebenswert und der psychischen Gesundheit ihrer Bewohnerschaft zuträglich sind. Denn: Die gebaute Umwelt in Form von Häusern, Quartieren, Städten und der einhergehenden Infrastruktur hat Auswirkungen darauf, wie Menschen sich fühlen. Während der körperliche Gesundheitszustand der Städter oft besser ist als der auf dem Land, so zeigt sich bei der psychischen Gesundheit ein anderes Bild.
Das Leben in der Stadt geht mit einem erhöhten Risiko für psychische Erkrankungen einher, erläutert Prof. Dr. Mazda Adli im BUWOG-Podcast. Studien zeigen, dass Stadtbewohner:innen ein deutlich höheres Risiko für Erkrankungen wie Depressionen haben. Der Zusammenhang ist so ausgeprägt, dass die Stadtgröße mit einer höheren Häufigkeit von Erkrankungen korreliert. „Je größer die Stadt, desto häufiger treten diese Erkrankungen auf“, so der Experte. Prof. Adli hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Ursachen dieses Phänomens zu erforschen und zu verstehen, wie das Stadtleben unsere psychische Gesundheit sowohl positiv als auch negativ beeinflusst.
Neurourbanistik: Psychologie trifft Stadtforschung
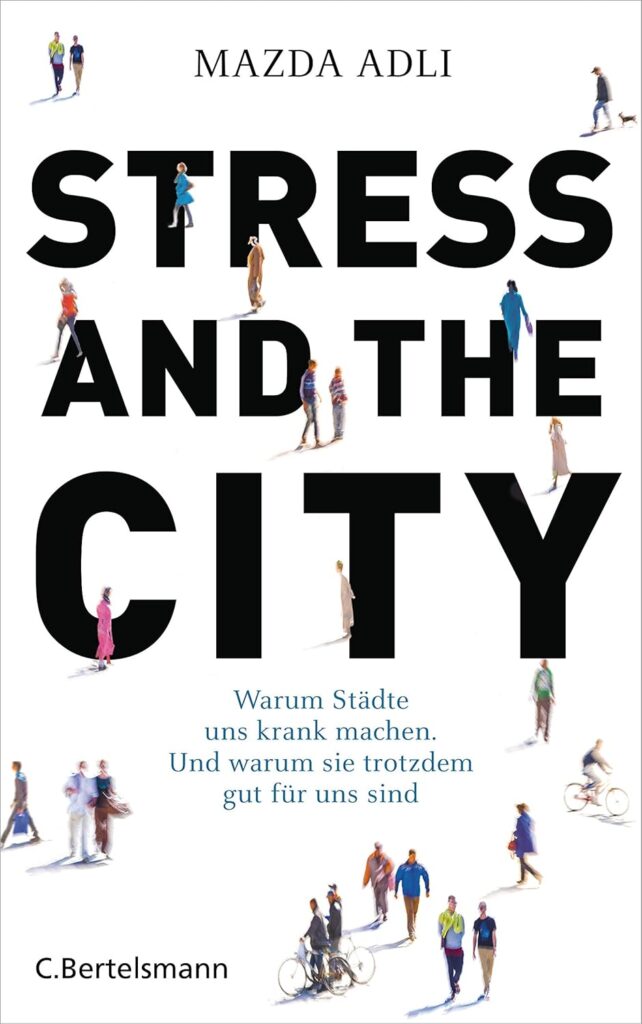
„Neurourbanistik beschreibt die Erforschung des Einflusses von Stadtleben auf das psychische Wohlbefinden“, erklärt Prof. Adli das Forschungsgebiet. In der Neurourbanistik werden verschiedene Disziplinen wie Medizin, Psychologie, Architektur und Stadtplanung kombiniert, um die komplexen Wechselwirkungen zwischen urbanen Räumen und der emotionalen Verfassung der Menschen besser zu verstehen. Das Forschungsgebiet der Neurourbanistik entstand als Antwort auf die Erkenntnis, dass die moderne Stadtgestaltung oft nicht den Bedürfnissen in Bezug auf emotionale und psychische Gesundheit gerecht wird. Prof. Adli betont, dass sozialer Stress eine entscheidende Rolle spielt, wie das Stadtleben unsere Psyche beeinflusst. Dieser „Stadtstress“ tritt in zwei Formen auf. Erstens gibt es den Dichtestress, etwa das Gefühl, ständig von Menschen umgeben zu sein, ohne genügend Rückzugsorte zu haben. Lärm, Stau, Überfüllung, beengtes Wohnen und die Hektik des urbanen Lebens können zu einem Gefühl der Überforderung führen. Zweitens gibt es den Isolationsstress, also das Gefühl der Einsamkeit, trotz der physischen Nähe zu vielen anderen Menschen.
Besonders belastend wird sozialer Stress, wenn er chronisch wird und das Gefühl entsteht, den eigenen Lebensraum nicht mehr beeinflussen oder verändern zu können, so Prof. Adli. Bei allen Qualitäten, die Städte auch bieten – wie ein umfassendes Angebot an Kultur, Gesundheitsversorgung, Freizeitmöglichkeiten – so hat das Stadtleben also zwei Seiten. In seinem Buch „Stress and the City – Warum Städte uns krank machen. Und warum sie trotzdem gut für uns sind“, (Verlag C. Bertelsmann) beleuchtet er diese Widersprüchlichkeit der Wirkung von Städten auf die Menschen.
Citizen-Science: Eine „emotionale Wetterkarte“ der Stadt
Welche Auswirkungen hat die gebaute Umgebung auf unser Wohlbefinden? Dieser Frage geht auch sein aktuelles Forschungsprojekt „Deine emotionale Stadt“ in Berlin auf den Grund. Spannend: Das Projekt ist als Citizen-Science-Studie angelegt und wird gemeinsam mit dem Futurium, Berlins Haus der Zukünfte, realisiert. Das heißt, alle Menschen in Berlin können aktiv daran teilnehmen und zur Forschung beitragen. Mithilfe der App „Urban Mind“ werden Daten gesammelt, die zeigen, wie Menschen sich an verschiedenen Orten der Hauptstadt fühlen. Über eine Woche hinweg geben die User:innen dreimal täglich ihre emotionale Verfassung an – verknüpft mit ihrem aktuellen Standort. Wo ist man einsam? Wo fühlt man sich sicher? Wo erlebt man Freude? Wo sind Stress-Hotspots der Hauptstadt?
Ein erster Blick auf die erhobenen Daten zeigt bereits interessante Muster: Orte, die als ästhetisch ansprechend bewertet werden, stehen in direktem Zusammenhang mit einem geringeren Stresslevel. Prof. Adli: „Einen Ort als schön empfinden, das hat einen ganz großen Effekt auf das emotionale Wohlbefinden der Menschen.“ Vielleicht kann also gute Architektur, die wir als ästhetisch empfinden, durchaus nicht nur den architektonischen Geschmack treffen sondern auch die Gesundheit der Bewohnenden verbessern.
Die App „Urban Mind“ ist kostenfrei verfügbar und bietet die Möglichkeit, aktiv an der Forschung teilzunehmen. Regelmäßige Rahmenveranstaltungen im Futurium begleiten das Projekt und liefern interessante Zwischenergebnisse. Am Ende wird eine „emotionale Wetterkarte“ von Berlin entstehen, die zeigt, welche Orte das psychische Wohlbefinden fördern – und welche eher belasten. Wie können Stadtplanung und die Bauenden selbst für eine gesunde Stadt sorgen? Auch auf diese wichtige Zukunftsfrage wird das Forschungsprojekt Antworten geben.
Gegen sozialen Stress: Stadtgestaltung der Zukunft
Was braucht es für eine Stadt, die den Menschen nicht überfordert, sondern stärkt? Laut Prof. Adli spielen Begegnungsräume eine zentrale Rolle, die dem Isolationsstress entgegenwirken. Öffentliche Plätze, vielseitig nutzbare und offene Quartiere sowie breite Gehwege schaffen bauliche Voraussetzung für Begegnung und soziale Interaktion. Von Vorteil sind Mischnutzungskonzepte: Wenn Wohnen, Arbeiten und Freizeit in einem Quartier kombiniert werden, fördert das eine lebendige Nachbarschaft. „Wir müssen Städte, Wohnräume und Arbeitsräume für soziale Wesen schaffen“, unterstreicht Prof. Adli. Gleichzeitig sollten die Bedürfnisse des Alltags fußläufig erreichbar sein. Denn: Wenn der Einkauf oder der Arztbesuch in der Nähe erledigt werden kann, führt das automatisch zu mehr Interaktion im direkten Wohnumfeld. Und jeder Schritt raus aus den eigenen Vier Wänden wirkt positiv gegen Isolation und Einsamkeit.
Auch Kulturstätten, Theater, Museen und Bibliotheken leisten einen wichtigen Beitrag zur mentalen Gesundheit, so der Experte. Sie bieten nicht nur Raum für Inspiration und Bildung, sondern wirken ebenfalls der sozialen Vereinsamung entgegen. Besonders wirkungsvoll für eine gesunde Umgebung sind auch Grünflächen in Wohnnähe. Studien zeigen, dass Menschen, die in der Nähe von Parks oder anderen grünen Oasen leben, weniger Stressreaktionen im Gehirn aufweisen – ein klarer Hinweis darauf, wie sehr die Umgebung das emotionale Wohlbefinden beeinflusst. „Grün geht direkt ins Gehirn“, so Prof. Adli. Der von ihm geleitete interdisziplinäre Verein „Forum Neurourbanistik e.V.“ hat eine Charta mit konkreten Empfehlungen für die Gestaltung von Städten entwickelt, um das psychische Wohlbefinden ihrer Bewohnenden nachhaltig zu verbessern. Ein Blick in die Charta lohnt sich für alle, die sich mit Stadtplanung, Architektur und der Realisierung von Gebäuden und Quartieren befassen – und damit die Städte der Zukunft aktiv mitgestalten.
Jetzt die ganze Folge hören!
Diese Beiträge könnten Sie ebenfalls interessieren:
- Podcast: Urbane Dichte: Wie gelingt nachhaltige Stadtentwicklung auf begrenztem Raum?
- Podcast: Wie gelingt die Mobilitätswende?
- Podcast: How2Kiez: Einfluss von Wohnungseigentümer:innen auf Nachbarschaften










